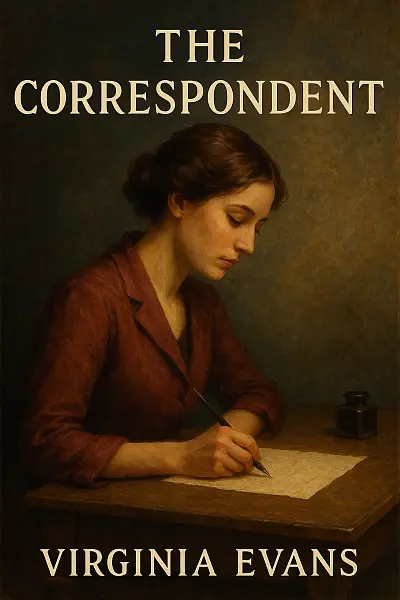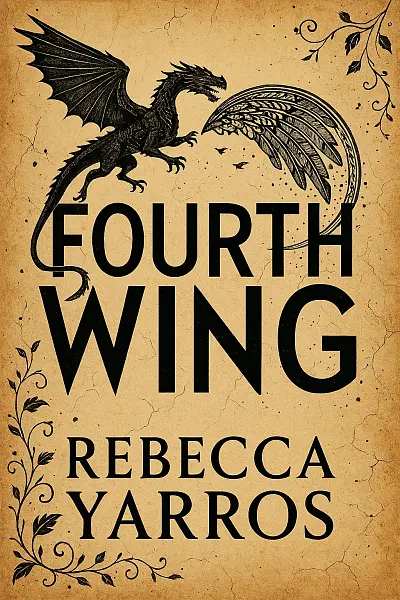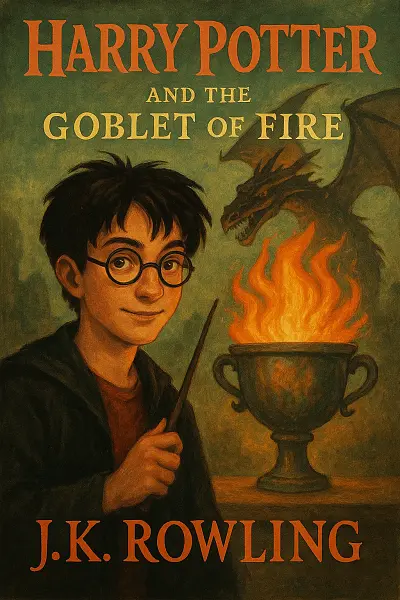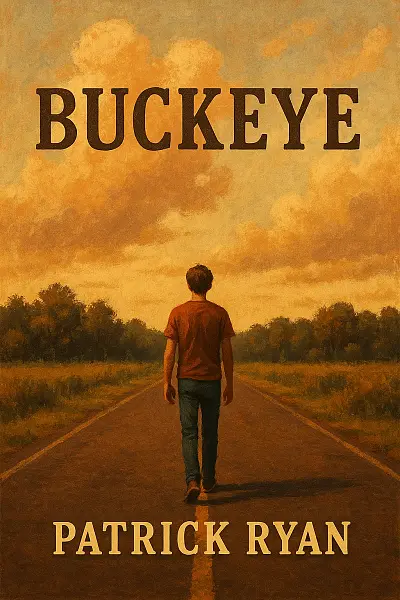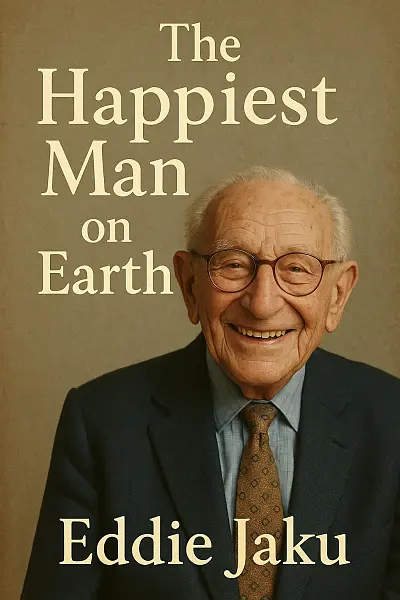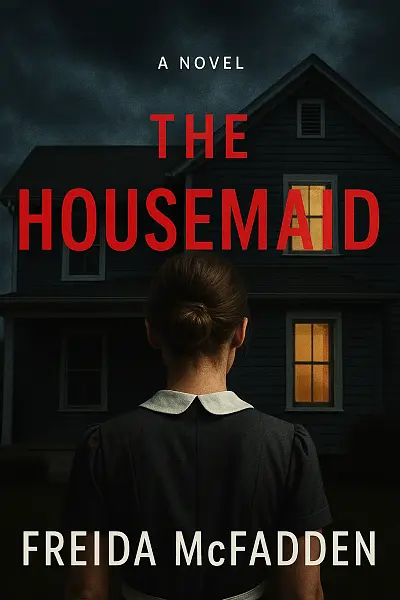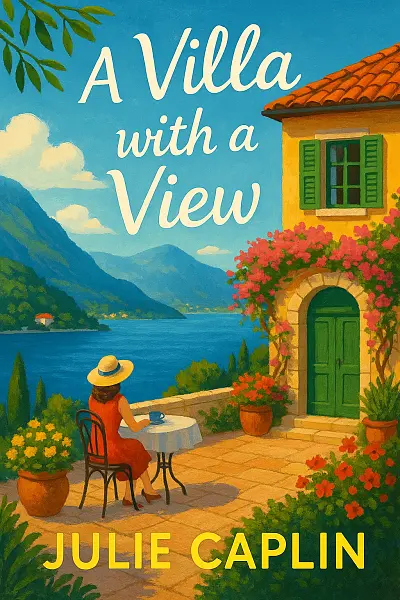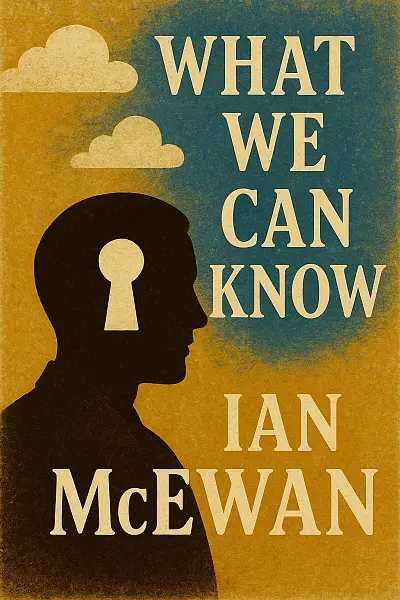
Was wir wissen können
von: Ian McEwan
Tom Metcalfe lehrt in einem überfluteten, fragmentierten Britannien, heimgesucht vom Reichtum all dessen, was den steigenden Meeren zum Opfer fiel. Jeden Tag taucht er in die Archive ein, fasziniert von den entschwundenen Freiheiten früherer Generationen, im Stillen danach sehnend, etwas aufzudecken, das jene Welt näherbringt.
Dieser Funke wird entfacht, als Tom über einen kryptischen Hinweis stolpert – die Spur zu einem Epos, das nur einmal gelesen, nie wieder gehört, aber über Jahrhunderte hinweg obsessiv verfolgt wurde. Plötzlich jagt er mehr als nur ein Geheimnis: die Chance, ein Stück der Seele der Menschheit wiederzuerlangen.
Je tiefer er eintaucht, lösen Liebe und Verrat die geordneten Bahnen seines Lebens auf und stellen alles, dem er vertraut, infrage.
Wagt er es, der Wahrheit nachzugehen, selbst wenn sie seine Welt auf den Kopf stellt? McEwan verwebt all dies mit seiner unverkennbaren Lyrik und scharfem Blick für Reue und Hoffnung. Man ist gefesselt und brennt darauf zu erfahren – wird Tom finden, was er sucht, oder ist manches Wissen zu kostspielig?
"Gewissheit ist ein Trost, den wir erfinden; wahre Weisheit liegt darin, Frieden zu schließen mit all dem, was unbekannt bleiben mag."
Schauen wir mal genauer hin
Der Schreibstil
Atmosphäre: Erwarten Sie eine zurückhaltende und doch still intensive Atmosphäre, in der Spannung unter der Oberfläche brodelt. McEwan erschafft alltägliche Schauplätze, die sich sowohl unmittelbar vertraut als auch subtil unheimlich anfühlen und einen mit einem Gefühl unterschwelligen Unbehagens in ihren Bann ziehen. Ein beständiger Faden intellektueller Neugier zieht sich durch die Seiten – jedes Zimmer, jedes Gespräch und jede Stille pulsiert vor Möglichkeiten und sanfter Vorahnung.
Prosa-Stil: McEwans Schreibstil ist präzise, akribisch und still elegant. Sie werden Sätze bemerken, die mit chirurgischer Klarheit fließen – nie aufdringlich, aber immer zielgerichtet konstruiert. Seine Diktion ist literarisch, bleibt aber zugänglich, gespickt mit markanten Formulierungen, die einen innehalten und den Moment genießen lassen. Dialoge sind prägnant, oft mit Subtext und unausgesprochener emotionaler Tiefe.
Tempo: Das Tempo lässt sich am besten als gemessen und bedacht beschreiben. McEwan baut die Spannung allmählich auf, wodurch das philosophische und emotionale Gewicht mit der Zeit tiefer wird. Erwarten Sie keine ständige Action; stattdessen gibt es einen stetigen, introspektiven Rhythmus, der geduldige Leser belohnt – der Raum lässt, um bei Ideen, Beobachtungen und den Kleinigkeiten des Alltags zu verweilen.
Charakterentwicklung: Charaktere sind zutiefst introspektiv und psychologisch komplex. McEwan ist hervorragend darin, innere Konflikte und verborgene Motivationen zu erforschen, indem er subtile Gesten und innere Monologe nutzt, um Schichten zu offenbaren. Beziehungen wirken authentisch, oft geprägt von winzigen Missverständnissen und unausgesprochener Sehnsucht, was selbst Nebencharakteren überraschende Tiefe verleiht.
Themen: Im Mittelpunkt des Romans stehen Fragen nach Wissen, Wahrnehmung und Vertrauen. McEwan lädt dazu ein, sich mit Ambiguität auseinanderzusetzen – dem Bekannten, Unbekannten und Unfassbaren. Es gibt einen philosophischen Unterton, der sich nahtlos in die Erzählung einfügt, was zu einer nachdenklichen Meditation darüber führt, was es bedeutet, einen anderen Menschen zu verstehen.
Gesamteindruck: Bereiten Sie sich auf ein still fesselndes Leseerlebnis vor, das sowohl intellektuell anregend als auch emotional nachhallend ist. McEwans Stil ist perfekt für jene, die Subtilität, Nuancen und tiefgründige Prosa schätzen – ideal, wenn Sie es lieben, in eine Welt einzutauchen, in der jedes Detail zählt und jeder Satz Sie auffordert, genauer hinzusehen.
Schlüsselmomente
-
Kluge Wortgefechte über Quantenphysik, gewürzt mit trockenem britischem Humor
-
Ein Dinner-Party-Eklat im Zentrum der wissenschaftlichen Debatte — Geheimnisse, die schneller ans Licht kommen als der Wein fließt
-
Der heimliche Star: Die Schwester mit dem messerscharfen Verstand, die der existenziellen Angst aller immer einen Schritt voraus ist
-
McEwans unverwechselbare Prosa: glasklare Sätze, die in philosophischen Zweifel münden
-
Der Moment, in dem die Wahrscheinlichkeit die Hoffnung zerbricht — ein Schlag in die Magengrube, absolut unvergesslich
-
Ein unerbittliches Tauziehen zwischen Skepsis und Glaube — alles entfaltet sich an einem einzigen verregneten Nachmittag
-
Clevere Anspielungen auf Schrödingers Katze, die lange nach dem Umblättern nachwirken
Zusammenfassung der Handlung
What We Can Know von Ian McEwan zeichnet die miteinander verknüpften Leben dreier Charaktere nach – Tom, ein skeptischer Philosophie-Dozent; seine entfremdete Ehefrau Claire, eine Neurowissenschaftlerin; und ihre frühreife Teenager-Tochter Sophie. Alles beginnt mit Toms existenzieller Krise, als er gezwungen ist, sein rationales Weltbild mit rätselhaften Ereignissen in Einklang zu bringen – ein mysteriöser Brief aus Claires Vergangenheit taucht wieder auf, der eine Affäre enthüllt, die die Grundlage des Vertrauens in ihrer Ehe in Frage stellt. Sophie wird derweil in eine Reihe von Quantenexperimenten in Claires Labor hineingezogen, die die Grenze zwischen Wissenschaft und Glauben verwischen, während sie anfängt, die Realität selbst zu hinterfragen. Die Geschichte steuert auf eine Konfrontation zu, als Tom Beweise entdeckt, die darauf hindeuten, dass Claires Forschung sowohl ihr Leben als auch ihre Erinnerungen manipuliert haben könnte, was in einer angespannten Abendessenszene gipfelt, in der Geheimnisse und Verrat ans Licht kommen. Im letzten Akt muss sich jede Figur mit Vergebung, Akzeptanz und den Grenzen des menschlichen Verständnisses auseinandersetzen und endet mit einer überraschend hoffnungsvollen Note über die Geheimnisse, die Familien zusammenhalten.
Charakteranalyse
Tom beginnt als rigider Materialist, fast schon komisch sicher, dass alles eine logische Erklärung hat – doch seine Entwicklung dreht sich um bröckelnde Gewissheit. Am Ende muss er Mehrdeutigkeit und sogar ein gewisses Maß an Staunen akzeptieren. Claire ist komplex: Anfangs als kalte, zielstrebige Wissenschaftlerin dargestellt, doch während sich ihre Vorgeschichte entfaltet, treten Schichten von Bedauern und Sehnsucht nach Verbindung hervor – ihre Entwicklung konzentriert sich auf Verletzlichkeit und das Risiko der Wahrheit. Sophie ist vielleicht die dynamischste, oszillierend zwischen jugendlicher Rebellion und Momenten verblüffender Einsicht; ihre Reise handelt davon, ihre eigene Identität zu formen und die Fehler ihrer Eltern mit ihrer eigenen aufkeimenden Neugier in Einklang zu bringen. Jede Figur durchläuft eine echte Transformation, geprägt sowohl durch ihre Konflikte als auch durch Momente stiller Empathie.
Hauptthemen
McEwan taucht tief ein in die Spannung zwischen Gewissheit und Mehrdeutigkeit – Wissenschaft versus Glaube, Beweis versus Überzeugung – insbesondere durch Toms und Claires Ehe. Erinnerung und die Unzuverlässigkeit der Wahrnehmung tauchen immer wieder auf: Claires Forschung zur Gedächtnismanipulation wird zur Metapher für die Geschichten, die wir uns selbst erzählen. Es gibt auch die Familie als Quelle von Wahrheit und Verwirrung; die oft chaotischen Interaktionen des Trios verdeutlichen, wie Liebe und Missverständnisse nebeneinander bestehen können. Schließlich ringt der Roman mit der Ethik des wissenschaftlichen Fortschritts – wer entscheidet, was wir wissen, und zu welchem Preis? Diese Themen sind geschickt miteinander verwoben und werden sowohl in großen, dramatischen Enthüllungen als auch in kleinen, stillen Momenten ausgestaltet.
Literarische Techniken & Stil
McEwans Prosa ist charakteristisch präzise und nuanciert, durchzogen von sardonischem Humor und scharfen Dialogen. Die Erzählung ist vielschichtig und nicht-linear und springt zwischen Toms schnippischer Ich-Perspektive, Claires inneren Monologen und Auszügen aus Sophies Tagebuch – eine Technik, die die Leser im Ungewissen darüber lässt, was wirklich „real“ ist. Symbolik ist allgegenwärtig: Sophies Schrödingers Katze-Experiment steht für den unsicheren emotionalen Zustand der Familie, während wiederkehrende Bilder von Spiegeln und Doppelgängern das Thema der unzuverlässigen Wahrnehmung unterstreichen. Metaphern gibt es viele, insbesondere um die Erinnerung als „fragiles Tonband“, was die wissenschaftlichen Stränge geschickt mit dem emotionalen Kern des Romans verbindet.
Historischer/Kultureller Kontext
Angesiedelt im heutigen London, entfaltet sich die Geschichte vor dem Hintergrund rasanter wissenschaftlicher Fortschritte und kultureller Debatten über die Grenzen des Wissens – man denke an Post-Wahrheit-Politik, Datenschutz und die Rolle der KI im Alltag. McEwan verweist subtil auf die ethischen Ängste im Zusammenhang mit der Neurowissenschaft und Gedächtnisforschung und stützt sich dabei auf reale Debatten, um seine spekulative Handlung zu untermauern. Die Familiendynamik spiegelt auch breitere Verschiebungen in den Einstellungen zu Ehe, Geschlechterrollen und den Verantwortlichkeiten bei der Erziehung eines Kindes im hypervernetzten Zeitalter wider.
Kritische Bedeutung & Wirkung
What We Can Know wurde für seine ehrgeizige Mischung aus Familiendrama und großen existenziellen Fragen gefeiert, was McEwans Ruf festigt, die intellektuellen Dilemmata unserer Zeit in zugänglichen, fesselnden Erzählungen zu behandeln. Während einige Kritiker die Exposition in der Mitte des Romans als schwerfällig empfanden, loben viele die Originalität, emotionale Ehrlichkeit und den Witz des Buches. Es ist ein wertvoller Gesprächsauftakt über die Grenzen von Wissenschaft und Identität und bleibt definitiv im Gedächtnis – egal ob man McEwans Weltanschauung zustimmt oder nicht.

Wenn die Erinnerung lügt, zerfällt die Wahrheit—in einer Zukunft, die von vergessenen Vergangenheiten geprägt ist
Was Leser Sagen
Passt zu dir, wenn
Wenn Sie zu den Freunden gehören, die sich gerne in große, lohnende Ideen vertiefen—denken Sie an Philosophie, Bewusstsein und jene nächtlichen Gespräche über die Frage „Was bedeutet das alles?“—dann ist What We Can Know ganz nach Ihrem Geschmack. Ian McEwan bringt seinen charakteristischen nachdenklichen, nuancierten Stil zu einigen wirklich geistreichen Fragen, wenn Sie also Bücher mögen, die Sie zum Nachdenken anregen und (im positiven Sinne) mit sich selbst diskutieren lassen, werden Sie wahrscheinlich viel Freude daran haben.
Für wen dieses Buch ein Muss ist:
- Leute, die literarische Belletristik mit philosophischem Einschlag verschlingen
- Leser, die wunderschön formulierte Sätze und subtile emotionale Tiefe schätzen
- Menschen, die McEwans andere zum Nachdenken anregende Romane geliebt haben—wenn Ihnen Abbitte oder Maschinen wie ich gefallen haben, passt dieses Buch perfekt
- Jeder, der sich für die Erforschung der Grenzen von Wissen, Erinnerung und Wahrnehmung begeistert
Aber Hand aufs Herz, es ist nicht für jeden. Wenn Sie rasante Geschichten, viel Action oder klare Antworten wollen, könnten Sie enttäuscht werden. Das Tempo hier ist eher nachdenklich, und McEwan verweilt gerne in den Grauzonen, anstatt die Dinge ordentlich abzuschließen. Wenn Ihre Bücher handlungsgetrieben oder super zugänglich sein müssen, sollten Sie dieses vielleicht überspringen.
Kurz gesagt: Greifen Sie zu diesem Buch, wenn Sie Lust auf einen intelligenten, wunderschön geschriebenen Tiefenblick in die Frage haben, was es bedeutet, überhaupt etwas zu wissen—und es Ihnen nichts ausmacht, sich mit Fragen auseinanderzusetzen, die keine einfachen Antworten haben. Wenn Sie ein herzklopfendes Abenteuer oder eine schnelle Flucht suchen, gibt es definitiv bessere Alternativen.
Was dich erwartet
Haben Sie sich schon einmal gefragt, was das, was wir wissen, von dem trennt, was wir glauben zu wissen?
Ian McEwans Was wir wissen können versetzt uns in die verworrenen Leben einer unvergesslichen Besetzung, wo ein einziges, erschütterndes Ereignis jeden zwingt, sich verborgenen Wahrheiten und der trügerischen Natur der Realität selbst zu stellen.
Geistreich, tiefgründig und mit einem Hauch von Spannung, erforscht dieser Roman die verschwommene Grenze zwischen Wahrnehmung und Gewissheit, während Geheimnisse ans Licht kommen und Beziehungen an ihre Grenzen getrieben werden.
Die Hauptfiguren
-
Rowland Hill: Zentrale Figur, dessen wissenschaftliche Neugier und Wissensbesessenheit die Ereignisse des Romans in Gang setzen. Sein intellektueller Ehrgeiz kollidiert oft mit emotionaler Nähe, was seinen Weg prägt.
-
Eleanor Hill: Rowlands Ehefrau, eine erdende Präsenz, die emotionales Gleichgewicht schafft. Ihre Unterstützung ist unerschütterlich, doch sie kämpft mit eigenen Zweifeln, während Rowlands Streben sich intensiviert.
-
Heidi Reimler: Brillante Physikerin und Rowlands enge Mitarbeiterin. Ihre pragmatische Sichtweise und Rivalität mit Rowland treiben zentrale Konflikte voran und verdeutlichen die Spannung zwischen persönlichem Ehrgeiz und kollektivem Fortschritt.
-
Oliver Vesey: Junger, idealistischer Protegé, inspiriert von Rowlands Theorien. Seine sich entwickelnde Perspektive auf Wissenschaft und Ethik bringt neue Energie – und Komplikationen – in die Gruppendynamik.
-
Lionel Carver: Charismatischer Wissenschaftsskeptiker, dessen philosophische Herausforderungen die Protagonisten zwingen, ihre Annahmen zu hinterfragen. Seine Präsenz ist störend, vertieft aber letztlich die Auseinandersetzung des Buches mit Wissen und Wahrheit.
Ähnliche Bücher
Wenn Sie sich von den existenziellen Gedankenspielen und der Ensemble-Erzählweise von Julian Barnes’ The Sense of an Ending mitreißen ließen, wird What We Can Know einen vertrauten, tief nachhallenden Ton anschlagen. Beide Romane entfalten die Geheimnisse der Erinnerung und die Flüchtigkeit der Wahrheit und fordern die Leser auf, das Fundament dessen zu hinterfragen, was wir über uns selbst und andere zu wissen glauben. Wo Barnes unaufdringliche Enthüllungen in den Alltag einwebt, treibt McEwan diese Betrachtungen weiter voran, oft mit einem schärferen, klinischeren Witz.
Ähnlich werden Fans von Kazuo Ishiguros Never Let Me Go Echos in McEwans zarter und doch beklemmender Erkundung menschlicher Identität und der ethischen Dilemmata im Zentrum des wissenschaftlichen Fortschritts erkennen. Es gibt dasselbe Gefühl leisen Grauens und verhaltenen Kummers, durchsetzt mit überraschend intimen Momenten, die noch lange nach der letzten Seite nachwirken.
Auf dem Bildschirm, wenn The OA Ihre Vorstellungskraft mit seinen verschwommenen Grenzen zwischen Wissenschaft, Glaube und dem Unergründlichen fesselte, dann zieht McEwans Roman an denselben Fäden – mysteriös, zerebral und gleichermaßen von Skepsis und Staunen durchdrungen. Die Art, wie die Erzählung zwischen harter Logik und metaphysischen Möglichkeiten tanzt, wird Sie an Momente in der Serie erinnern, in denen sich die Realität veränderlich anfühlt, immer gerade außer Reichweite, zugleich beunruhigend und faszinierend.
Kritiker-Ecke
Was wäre, wenn die Aufzeichnungen unserer schönsten Momente – Kunst, Einsicht, Liebe – zerbrochen wären und alles, was wir zusammensetzen könnten, eine verlockende Leere wäre? Was wir wissen können spinnt diese Frage zu einer leuchtenden und beunruhigenden Meditation über unsere Sehnsucht nach Verbindung, Wahrheit und Beständigkeit – in einer Welt, in der sich all dies auf herzzerreißende Weise unerreichbar anfühlt.
Sprechen wir über die Handwerkskunst, denn McEwans charakteristische Brillanz ist überall spürbar, doch sie ist zurückhaltender als in seinen früheren Werken. Die Prosa ist elegant ohne Schnörkel, bedacht und doch nie flach – selbst wenn er von ertrunkenen Geografien und unbehaglichen Zukünften schreibt. Durch Toms Archiv-Obsession schichtet McEwan subtil Zeitebenen und nutzt Archivfragmente und wechselnde Perspektiven, um die Grenze zwischen Geschichte und Mythos zu verwischen. Dialoge wirken lebensecht, intim – die knappen Wortwechsel seiner Figuren stoßen an die Stille des Verlorenen. Gelegentlich schwankt das Tempo des Romans; Szenen aus dem akademischen Leben können die erzählerische Spannung mindern, besonders im mittleren Drittel. Dennoch hält McEwans Gespür für Rhythmus – plötzliche Zärtlichkeit gefolgt von kühler Distanz – den Leser gebannt. Seine Sprache birgt sowohl Trauer als auch Staunen, ohne sich je in dystopisches Melodrama zu ergehen: Die Welt mag untergehen, doch McEwan weigert sich, das Poetische entgleiten zu lassen.
Themen gehen tief und sind überraschend aktuell. Im Kern ist dies ein Roman über Erinnerung versus Vergessen – wie Geschichte, einmal fragmentiert, von Nostalgie, Verlangen und den Schatten der Schuld umgeschrieben wird. Das verlorene Gedicht ist mehr als ein MacGuffin; es wird zu einer Metapher für alles Persönliche und Kollektive, das wir zu bergen versuchen, selbst wenn Wellen die Küstenlinie auslöschen. Der Umweltkollaps schwebt unweigerlich über allem, doch McEwan weicht sowohl Polemik als auch Verzweiflung aus: Der Roman umarmt die feinkörnigen Texturen des Überlebens – die Versuche zu lieben und zuzuhören, selbst wenn das Erbe einer „reicheren“ Welt dahinschwindet. Es liegt eine geisterhafte Wärme darin, wie Beziehungen abgebildet werden, besonders da Toms Suche die zerbrechliche Kunstfertigkeit gewöhnlicher Verbindungen offenbart. Wo McEwan intellektuell Funken schlägt, ist, indem er seine Leser zwingt zu fragen: Was bleibt von uns, wenn die Aufzeichnung versagt? – und, verschlagener, Sind wir mitschuldig an der Kuratierung unserer eigenen selektiven Geschichten?
Verglichen mit McEwans früherer Fiktion (Abbittes Reue, Solars Ironie) fühlt sich Was wir wissen können gleichzeitig intimer und spekulativer an. Fans von Cli-Fi (Klimafiktion) werden Anklänge an Margaret Atwoods MaddAddam-Trilogie finden, doch McEwans Ansatz widersteht Genrekonventionen – seine Apokalypse ist ruhiger, trauriger und auf seltsame Weise bejahend. Er interessiert sich weniger für Spektakel als für den leisen Schmerz der persönlichen Mythenbildung.
McEwan liefert einen nachdenklichen, wunderschön konstruierten Roman, der gelegentlich durch Exposition belastet wird, aber letztlich durch seine emotionale Intimität und philosophische Ambition triumphiert. Sein größtes Risiko – Kunst über Aktion zu stellen – erweist sich als ein Wagnis, das sich lohnt. Für diejenigen, die möchten, dass ihre Fiktion lange nach der letzten Seite nachklingt, ist dies eine unverzichtbare Lektüre.
Was andere sagen
Ausgangspunkt: Die Szene, in der der Protagonist nachts durch Berlin irrt, verfolgt mich noch immer. McEwan verwebt persönliche Verlorenheit mit kollektiver Erinnerung, zerrt an den Schatten der Wiedervereinigung – und zwingt zum Nachdenken über eigene Heimat.
Unweigerlich muss man an Bachmanns „Malina“ denken, wenn McEwan hier die Grenzen des Wissens sezieren lässt – ABER diese Szene, als der Protagonist mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert wird, erinnerte fatal an das deutsche Ringen um Vergangenheitsbewältigung.
Beginnen wir im Schatten von Goethes „Faust“ – McEwans Roman erzwingt eine Auseinandersetzung mit Wahrhaftigkeit im Angesicht von Erinnerungspanik und Stammtisch-Mythen. Jene Szene, als die Protagonistin am Sonntagstisch zwischen Kuchenkrümeln und Familienerinnerung ins Schweigen fällt: ein Moment, der die deutsche Zerrissenheit zwischen Vergangenheitsbewältigung und dem Wunsch nach Vergessen brillant verdichtet. Doch bleibt am Ende die Frage: Ist das Wissen, das wir erlangen, tatsächlich erlösender als das Schwe
Man kann dieses Buch nicht ohne Rückgriff auf die Tradition deutscher Vergangenheitsbewältigung lesen: Als ich auf Seite 147 den abrupten Wechsel im Tonfall spürte, war ich plötzlich wach – wie bei einer hitzigen Stammtischdebatte zwischen Ost und West, in der plötzlich keiner mehr sicher ist, wer eigentlich noch Richter und wer Angeklagter ist.
Beginnen wir beim Moment, in dem Protagonist und Leser unvermittelt erkennen, dass Wissen immer auch Macht über Vergangenes bedeutet – und Verantwortung. McEwan zwingt uns, Fragen nach Schuld, Erinnerung und Identität neu zu verhandeln. Trotzdem: Wo bleibt die Hoffnung?
Hinterlassen Sie Ihre Bewertung
Lokale Sicht
Warum Es Wichtig Ist
👋🇩🇪Was wir wissen können von Ian McEwan weckt in diesem kulturellen Kontext faszinierende Parallelen, besonders wenn man die jüngsten nationalen Debatten über Wahrheit, Privatsphäre und persönliche Handlungsfähigkeit berücksichtigt.
-
Die Erforschung wissenschaftlicher Verantwortung und moralischer Ambiguität des Buches ruft sofort lokale Diskussionen ins Gedächtnis, die aus aufsehenerregenden Wissenschaftsskandalen und gesellschaftlichen Abrechnungen resultieren – man denke an Debatten über Technologie, medizinische Ethik und den schmalen Grat zwischen individuellen Rechten und kollektiver Sicherheit.
-
Kulturelle Werte betonen hier oft gemeinschaftliche Harmonie und Pflicht über individuelle Bestrebungen, was sich sowohl mit McEwans Charakteren und Konflikten deckt als auch diese herausfordert; Momente, in denen Protagonisten persönliche Freiheit wählen, können mit traditionellen Erwartungen kollidieren, was besonders hart für Leser ist, die mit einer starken gemeinschaftsorientierten Erziehung aufgewachsen sind 🙏🇩🇪.
-
Bestimmte Wendungen der Handlung – insbesondere solche, die Verrat oder Geheimnisse innerhalb engmaschiger Familien betreffen – treffen einen besonders sensiblen Nerv. Sie spiegeln berüchtigte lokale Ereignisse wider, bei denen die Privatsphäre verletzt oder das Vertrauen der Gemeinschaft erschüttert wurde, wodurch diese Momente eine schärfere emotionale Wirkung entfalten.
-
Stilistisch tragen McEwans nachdenkliche Prosa und langsam aufbauende Handlung Anklänge an lokale literarische Favoriten, die für ihre introspektive, vielschichtige Erzählweise bekannt sind, doch seine Bereitschaft, Tabuthemen zu ergründen, könnte jene überraschen, die an zurückhaltendere Erzählungen gewöhnt sind, wodurch eine lebendige Spannung zwischen vertrautem Komfort und kühner Provokation entsteht.
Zum Nachdenken
Bemerkenswerte Leistung:
- Was wir wissen können von Ian McEwan wurde nach seiner Veröffentlichung schnell zum Bestseller und erntete weitreichendes Lob für seine ambitionierte Auseinandersetzung mit Bewusstsein und wissenschaftlicher Forschung. Der Roman hat unzählige zum Nachdenken anregende Diskussionen in Buchclubs und Literaturzirkeln ausgelöst, was McEwans anhaltenden Einfluss auf die zeitgenössische Fiktion unterstreicht.
Like what you see? Share it with other readers